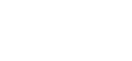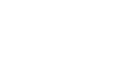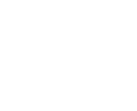Evangelische Kirchengemeinde Groß Särchen,
Wittichenauer Str. 1, 02999 Lohsa-Groß Särchen
„Erzähl mir was aus deinem Leben, daß ich dich
besser verstehen kann…“: beginnen wir mit dem
klassischen Eingangssatz jedes Lebenslaufes: „Ich,
die evangelische Kirche von Groß Särchen, wurde am
…. 1782 eingeweiht“, mit der klaren, uns in Stein
gehauen überlieferten und so auch gepredigten
Bestimmung: „Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein
Wort ist die Wahrheit.“ Mit ungewöhnlich dickem
Mauerwerk steht sie auf einer kleinen
Bodenerhebung überschwemmungssicher über dem
Schwarzwasser, seit je vom Friedhof umgeben. Von
außen ein einfacher, schlichter Baukörper, und so
bietet sich auch der Innenraum dem
Gottesdienstbesucher. Eine Predigtkirche im
Übergang zum Kunststil des Klassizismus. Der Raum
ist ganz auf Altar und Kanzel ausgerichtet, die in eins
gesetzt sind, auf beiden Seiten je zwei Emporen. Auf
der Westseite eine Orgel mit zwei Manualen und
Pedal, 1868 unter der Firma Friedrich Ladegast von
Conrad Geissler erbaut.
Das Einweihungsjahr 1782 ist außen über dem
Südeingang zu lesen. Da muß es einem sehr
aufmerksamen Besucher auffallen, daß die
Wetterfahne auf dem kantigen Turm, in 31 Meter
Höhe, eine ganz andere Jahreszahl trägt: 1750. Und
das heißt ja nicht anderes als daß er älter ist als die
Kirche. Das führt uns auf die Geschichte der Kirche,
die in ihrer jetzigen Gestalt tatsächlich bereits das
dritte Gotteshaus an gleicher Stelle ist. Irgendwann
zwischen der ersten urkundlichen Erwähnung des als
„Zore“ (das Wort belegt seine Gründung durch
slavische/sorbische Siedler) um 1374/1385 und der
ersten Erwähnung im Jahr 1495 ist das erste Kirchlein
gebaut worden. Es war der damals sehr beliebten
Heiligen Barbara geweiht, die zu den Vierzehn
Nothelfern gerechnet wird. Zwei Zeugnisse aus
diesem Kirchlein haben die Jahrhunderte überdauert:
einmal die sog. „mensa“, das ist der Altarstein, ganz
grob behauen; er steht jetzt m Turmeingang, zum
anderen der spätgotische Corpus eines Kruzifixus.
Und vielleicht war auch der jetzige eingewölbte
Westeingang einmal der steinerne Glockenturm der
ersten Kirche,
Ob das Kirchlein abbrannte oder einfach zu klein und
baufällig wurde? Jedenfalls errichtete die Gemeinde,
die im Jahr 1542 ihren ersten evangelischen Pfarrer
erhielt, (um) 1692 eine neue Kirche; wir haben Grund
zu der Annahme: Fachwerk aus steinernem Sockel.
Zweihundert Jahre später genügte auch diese Kirche
nicht mehr, sie wurde niedergerissen und am 3.
Adventssonntag 1782 nach eineinhalbjähriger
Bauzeit die jetzige Kirche geweiht.
Es ist aber bemerkenswert - rechnen mußten die
Kirchväter damals auch! - , daß man aus der
Vorgängerkirche Kanzel und Altar übernommen hat.
Mit einer wesentlichen Änderung freilich: man setzte
den Kanzelkorb an Stelle eines ursprünglichen
Altarbildes mitten in den Altar hinein. Und das
Altarbild wurde, der Gemeinde jetzt fast unsichtbar,
in die Kanzeltür eingepaßt: eine recht gute, sehr
lebendige Darstellung der Abendmahls-Szene, Öl auf
Leinwand, um 1600 gemalt.
Die lange vergessene Namenspatronin, Barbara,
bekam Ende des letzten Jahrhunderts einen Platz am
Kanzelkorb. Mit dem Turm in ihrer Hand, Zeichen
ihrer Standhaftigkeit im Glauben, schaut sie in die
Gemeinde. Zur Rechten und Linken zwei Frauen aus
dem Alten und Neuen Testament: die Prophetin
Mirjam, tanzend mit der Pauke in der Hand, deren
Siegeslied (nachzulesen im 2. Buch Mose Kap. 15
Vers 21) das älteste uns aufgeschriebene gesungene
Gotteslob ist, und die Frau, der Jesus am
Jakobsbrunnen begegnet und ihren Lebensdurst
stillt (lies im 4. Kapitel des Johannes-Evangeliums).
Die schmiedeeisernen Gitter der Seitentüren sind
eine Bildpredigt: auf der Nachtseite Sündenfall
(Adam und Eva) und Brudermord (Kain und Abel), auf
der Mittagsseite Kreuzigung und Auferstehung Jesu.
Das ganze Elend des Menschen und die ganze
liebende Zuwendung Gottes ist in diesen vier
Geschichten: Schuld und Tod, Vergebung und Leben.
Oder, verschränkt zu lesen: Schuld und Vergebung,
Tod und Leben.
Über zwanzig „pastores“, d.h. Hirten, hat die
Gemeinde seit der Reformation gehabt; erstaunlich
wenige, was auf ein wohlhabendes Dorf schließen
läßt, das auskömmlichen Lebensunterhalt sichern
konnte.
Womit wir bei dem Dorf sind, in dessen Mitte die
Kirche steht. Zu ihm soll doch wenigsten dieses
gesagt werden, daß es „aus slavischer Wurzel“, also
nicht von deutschen Siedlern, angelegt wurde, und
daß es bis etwa zum Jahr 1900 ein rein sorbisches
Bauern- und Häusler-Dorf geblieben ist, weitab vom
großen Weltgeschehen. Aber recht selbstbewußt:
bereits im Jahr 1510 rang es dem Grundherrn, das
war die Standesherrschaft Hoyerswerda, in einem
Vertrag größere Freiheitsrechte ab; im Jahr 1799
kaufte es das Särchener Vorwerk auf und verteilte
das Land unter die eigenen Leute. Das Leben des
Dorfes änderte sich gründlich, seit Anfang des 20.
Jahrhunderts die riesigen Braunkohlevorkommen
erschlossen wurden; und es änderte sich abermals,
als nach der „Wende“ 1989 mit dieser Industrie,
verbunden mit dem Namen
Werminghoff/Knappenrode, den Leuten ihre
wirtschaftliche Grundlage wegbrach. Seitdem ist das
Dorf still geworden und die Kirchengemeinde klein,
zu der noch die umliegenden Dörfer Maukendorf,
Koblenz und Rachlau gehören.
Aufgeschrieben von Pastor em. Dietmar Neß


Geschichte